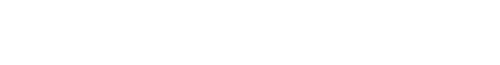Strafrecht in den Bundestagswahlprogrammen 2025
Der Wahlkampf für die anstehende Bundestagswahl läuft auf Hochtouren. Dabei greifen die Parteien in ihren Wahlprogrammen auch verschiedene strafrechtliche Themen auf. Im Folgenden sollen daher die wesentlichen Vorhaben auf dem Bereich des Straf- sowie Wirtschaftsstrafrechts zusammengefasst und Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Forderungen herausgearbeitet werden. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Frage, wie es mit der strafrechtlichen Haftung von Unternehmen und Unternehmern weitergehen soll („Unternehmensstrafrecht“).
- Das allgemeine Strafrecht
Gemeinsamer Ausgangspunkt: Stärkung der Justiz
Trotz der Differenzen im Detail machen die Wahlprogramme aller Parteien übereinstimmend das dringende Bedürfnis nach einer Stärkung der Justiz deutlich. Die Justiz dürfe, so etwa die SPD, „nicht zum Flaschenhals werden“. Dementsprechend wollen sich alle Parteien für eine bessere personelle wie materielle Ausstattung der Justiz einsetzen. Grüne und SPD setzen insoweit insbesondere auf einen weiteren Ausbau der Digitalisierung. Zur weiteren Entlastung der Strafverfolgungsbehörden will das BSW darüber hinaus auf eine Reduktion der Verfahrenszahlen hinwirken, womit ggf. eine Erweiterung der §§ 153 ff. StPO gemeint sein dürfte. Die FDP hat noch im Dezember 2024 einen ausformulierten Gesetzentwurf zur Reform der StPO vorgestellt. Dieser beinhaltete Forderungen zur Modernisierung des Strafverfahrens, wie etwa erweiterte Möglichkeiten zur Hauptverhandlungsunterbrechung oder Verlesung von Urkunden. Daneben war eine Stärkung der Beschuldigtenrechte vorgesehen, etwa durch die Einführung des „Verteidigers der ersten Stunde“, den Schutz von Anbahnungsgesprächen oder die Einführung eines strafprozessualen Beweisverwendungsverbotes, sofern den Betroffenen außerhalb des Strafverfahrens eine Kooperationspflicht trifft. Damit hat die FDP-Fraktion bereits sehr konkrete Forderungen formuliert, die erkennbar weiterhin Teil der politischen Agenda sind.
Verwirklichung des Ultima-Ratio Prinzips im Strafrecht
Strafrecht darf immer nur die Ultima Ratio sein. Im Zeichen dessen greifen die Parteiprogramme unterschiedliche Entkriminalisierungsmöglichkeiten auf. Die Grünen wollen prüfen, ob geringfügige Delikte außerhalb des Strafrechts geregelt werden können und betonen insoweit auch die justizentlastende Wirkung. Die FDP sieht ebenfalls eine Überprüfung auf überholte Straftatbestände vor und plant etwa die Streichung des Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB) sowie des „Schwarzfahrens“ (§ 265a StGB). Beides war bereits in der jetzt ablaufenden Legislaturperiode durch den vormaligen Bundesjustizminister im Rahmen des Eckpunktepapiers des BMJ eingebracht worden. Offensichtlich hält die FDP an dieser Forderung fest.
Die Linke will dagegen das „Containern“ entkriminalisieren sowie Strafbarkeitsrisiken für IT-Sicherheitsforscher abschaffen. Letzteres sah bereits ein Ende 2024 vom BMJ veröffentlichter Referentenentwurf vor, der in dieser Legislaturperiode jedoch nicht mehr verwirklicht werden konnte. Das BSW sieht zudem eine Streichung des § 188 StGB vor, der Politiker vor Beleidigungen schützen soll, da diese sich der Kritik der Bürger stellen müssten.
Zukünftiger Umgang mit Cannabis
Die ursprüngliche Kontroverse um die weitgehende Legalisierung von Cannabis spiegelt sich auch in den Parteiprogrammen wider. Während die Ampelparteien fordern, die Legalisierung beizubehalten, sieht die Linke eine vollständige Legalisierung vor und will dafür die notwendigen Rahmenbedingungen auf EU- und völkerrechtlicher Ebene schaffen. CDU/CSU und AfD sehen indes vor, die Cannabislegalisierung wieder zurückzunehmen.
Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen
Ähnlich konträr fallen die Bewertungen der strafrechtlichen Erfassung von Schwangerschaftsabbrüchen aus. Während die FDP vorschlägt, Reformen der §§ 218, 218a StGB fraktionsübergreifend und auf Grundlage der Gewissensfreiheit zu beraten, lehnt die CDU/CSU eine Reform ab. Die AfD fordert zudem, Werbung für Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten. Das BSW setzt sich demgegenüber für eine grundsätzliche Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Woche ein. SPD und Grüne wollen selbstbestimmte Schwangerschaftsabbrüche außerhalb des Strafrechts regeln, während die Linke darüber noch hinausgeht und eine ersatzlose Streichung der Tatbestände fordert.
Strafverschärfungen und -erweiterungen
Verschiedentlich sehen die Wahlprogramme eine Verschärfung bereits bestehender strafrechtlicher Instrumente vor. So fordern CDU/CSU und SPD härtere Bestrafungen für Angriffe auf Einsatzkräfte, während das BSW insoweit mit einer schnelleren Anklage und einem früheren Beginn der Strafvollstreckung operieren will. Die CDU/CSU fordert zudem härtere Strafen für Stalking und Gruppenvergewaltigungen. Dasselbe soll bei Körperverletzungen gelten, insb. wenn sie mit einem Messer begangen werden. Ob Letzteres in Anbetracht des in § 224 I Nr. 2 StGB vorgesehenen Strafrahmens von Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren tatsächlich geboten ist, wird durchaus kontrovers diskutiert.
Darüber hinaus erkennen CDU/CSU, Grüne und Linke das im Bereich des Tierschutzstrafrechts bestehende Vollzugsdefizit an und setzen sich für eine konsequentere Durchsetzung des strafrechtlichen Tierschutzes ein. Des Weiteren sieht die SPD eine strafrechtliche Regelung für „Catcalling“ vor.
Erweiterungen des materiellen Strafrechts sieht etwa die Linke vor, wenn gefordert wird, die Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern (§ 108e StGB) auch auf nachträgliche „Dankeschön-Spenden“ und Bestechungen zur „Imagepflege“ zu erweitern. Schließlich erfasst § 108e StGB nachträglich vereinbarte Zuwendungen oder die allgemeine „Klimapflege“ derzeit – anders als die §§ 331, 333 StGB – nicht.
Außerdem schlägt die SPD zur Steuerung der Mietpreisentwicklung unter anderem ein verstärktes Vorgehen gegen Mietwucher vor, was insbesondere durch eine Verschärfung des Wirtschaftsstrafrechts realisiert werden soll. Gemeint sein dürfte damit weniger der auf individuelle Zwangslagen bezogene § 291 I 1 Nr. 1 StGB, sondern vielmehr § 5 WiStG 1954, welcher den mietbezogenen Sozialwucher erfasst. Bereits in der 18. Legislaturperiode hat die Große Koalition einen Vorstoß zur Änderung der Vorschrift unternommen, der sich letztlich jedoch nicht durchsetzen konnte. Auch wenn sich an der grundsätzlichen Reformbedürftigkeit der Vorschrift nichts geändert hat, bleibt dennoch zu bedenken, ob sich die Reformziele insoweit nicht bereits durch eine Anpassung der zivilrechtlichen Regeln zur Mietpreisbremse (§§ 556d ff. BGB) erreichen lassen.
Strafverfolgung im digitalen Raum
Die Strafverfolgung im digitalen Raum nimmt eine immer größere Rolle im Rahmen strafrechtlicher Sozialkontrolle ein. Entsprechend fordert etwa die SPD die Schaffung einer sog. „Log-In-Falle“ zur Stammdatenerfassung. Grüne und FDP sehen unter Ablehnung der Vorratsdatenspeicherung die Einführung des „Quick-Freeze-Verfahrens“ zur Sicherung von Verkehrsdaten vor. Die Linke will demgegenüber das Recht auf informationelle Selbstbestimmung stärken und lehnt etwa Online-Durchsuchungen ab.
Ministerielles Weisungsrecht
Auch das umstrittene ministerielle Weisungsrecht gegenüber der Staatsanwaltschaft hat Eingang in die Wahlprogramme gefunden. Zur Gewährleistung einer unabhängigen Staatsanwaltschaft wollen AfD und BSW das Weisungsrecht vollständig abschaffen. Die Grünen halten demgegenüber zwar grundsätzlich am Weisungsrecht fest, sprechen sich jedoch – ohne Nennung näherer Modalitäten – für eine transparentere Ausgestaltung aus, um eine politische Einflussnahme zu verhindern.
- Forderungen zum Wirtschaftsstrafrecht
Verschärfung des Einziehungsrechts und verstärktes Vorgehen gegen Geldwäsche
Wirtschaftliches Gewinnstreben stellt die wesentliche Triebfeder der organisierten Kriminalität bzw. Wirtschaftskriminalität dar. Um potenziellen Straftätern von vornherein jeglichen wirtschaftlichen Anreiz zu nehmen, sprechen sich CDU/CSU, AfD, Grüne und FDP für eine konsequentere Durchsetzung der Vermögensabschöpfung aus.
CDU/CSU und AfD schlagen konkret die Einführung einer Beweislastumkehr im Rahmen des § 76a IV StGB vor, sodass dem potenziellen Empfänger einer Einziehungsanordnung der Beweis obliegen soll, dass das betroffene Vermögen aus legalen Quellen stammt. Diese Forderung ist nicht neu und fand sich bereits im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD zur 18. Legislaturperiode wieder. Bislang konnte sich die Forderung jedoch nicht durchsetzen. Zum einen bestehen bei einer solchen Beweislastumkehr erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Zum anderen ist bereits das Bedürfnis nach einer Beweislastumkehr fraglich. So sieht § 437 StPO ohnehin die Anlehnung an zivilprozessuale Beweisregeln sowie die Möglichkeit vor, das grobe Missverhältnis zwischen dem Wert eines Gegenstandes und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen bei der gerichtlichen Überzeugungsbildung zu berücksichtigen.
Mit Blick auf die Bekämpfung wirtschaftlich motivierter Kriminalität sehen CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP zudem vor, das Vorgehen gegen Geldwäsche zu intensivieren. Während die FDP ihre Forderung nicht näher konkretisiert, wollen die anderen drei Parteien die Zuständigkeit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in einer Behörde konzentrieren und deren Befugnisse ausweiten. Die SPD plant zudem, das Transparenzregister weiter auszubauen, um die Verschleierung inkriminierten Vermögens zu verhindern.
Ausbau der Strafverfolgung auf europäischer Ebene
In Bereichen wie dem IT- oder Wirtschaftsstrafrecht werden Straftaten zunehmend über Ländergrenzen hinweg begangen. Daher sprechen sich CDU/CSU, SPD, Grüne und FDP für eine Stärkung der Strafverfolgung in Europa aus. Die Rolle von Europol sehen Grüne und FDP dabei perspektivisch nicht mehr nur als transnationaler Koordinator bzw. Unterstützer nationaler Ermittlungen, sondern als echtes europäisches Kriminalamt mit eigenen Ermittlungsbefugnissen. Die SPD schlägt dagegen vor, die Zuständigkeitskompetenz der Europäischen Staatsanwaltschaft zu erweitern und künftig auch auf Umweltdelikte zu erstrecken. Transnationale Auswirkungen sind auch im Bereich der Umweltkriminalität nicht selten.
Streitpunkt Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)
Bereits vor seiner Verabschiedung war das LkSG rechtspolitisch umstritten, was sich nun auch in den jeweiligen Wahlprogrammen widerspiegelt. In der praktischen Umsetzung hat das Gesetz die Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen gestellt, weshalb von der Bundesregierung bereits vor dem Ampel-Aus die Abschaffung bzw. jedenfalls eine Entschärfung des LkSG in Aussicht gestellt worden ist. In ihren jeweiligen Wahlprogrammen schlagen nun CDU/CSU und FPD die Abschaffung des LkSG vor, die AfD darüber hinaus auch die Abschaffung der EU-Lieferkettenrichtlinie (CSDDD). Das BSW will die Pflichten zur Nachhaltigkeitsberichterstattung als Sofortmaßnahme aussetzen und eine Reform des LkSG vornehmen, die insbesondere eine Anhebung der Schwellenwerte umfassen soll, um die besonders belasteten kleinen und mittleren Unternehmen zu entlasten.
Während eine Reform des LkSG durchaus möglich erscheint, wäre eine vollständige Abschaffung der darin normierten Pflichten nach aktueller Rechtslage mit europäischen Vorgaben nicht vereinbar. Schließlich müssen die Vorgaben der CSDDD bis zum 26.7.2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Diese stellt ähnliche Pflichten auf wie das LkSG. SPD und Grüne fordern daher eine konsequente Umsetzung der CSDDD, während die Linke darüber noch hinausgeht und einen Ausbau des LkSG vorschlägt.
- Verwirklichung des Unternehmensstrafrechts weiter offen
Bereits seit langem wird die Schaffung eines originären Unternehmensstrafrechts gefordert. Der 2019 veröffentlichte Referentenentwurf der Großen Koalition zum Verbandssanktionengesetz wurde letztlich nicht realisiert. Auch die im Ampel-Koalitionsvertrag enthaltene Überarbeitung der Unternehmenssanktionen wurde nicht verwirklicht. Bemerkenswerterweise wird die Forderung nach einem originären Unternehmensstrafrecht trotz der großen rechtspolitischen Relevanz des Themas lediglich im Wahlprogramm der Linken aufgegriffen, während die restlichen Parteien sich hierzu nicht verhalten. Ob es damit in der kommenden Legislaturperiode zu einer Einrichtung eines „echten“ Unternehmensstrafrechts kommen wird, ist somit offen und wird sicherlich auch von der nächsten Regierungskonstellation abhängen. In der Sache spricht aber einiges dafür, dass es zu einer Reform kommen könnte. In der Praxis ist zu beobachten, dass zunehmend Verfahren nach §§ 30, 130 OWiG gegen Unternehmen eingeleitet werden.
Nach unbestätigten Informationen gab es schon in der ablaufenden Legislaturperiode im BMJ sehr konkrete Erwägungen zur Reform, die vor allem das Sanktionenrecht im Blick hatte. Erwogen wurde wohl das Sanktionsverfahren zu reformieren und die Sanktionshöhe am Gewinn des Unternehmens auszurichten. Außerdem sollte vor dem Hintergrund der Entscheidung des BVerfG zu Jones Day der Beschlagnahmeschutz für Unternehmen gestärkt werden. Die Problematik um die Beschlagnahmefähigkeit von Unterlagen aus Internal Investigations hat sich nunmehr verfestigt, nachdem auch der EGMR die Durchsuchung bei Jones Day in einer kürzlich ergangenen Entscheidung für rechtmäßig befand (22.10.2024 – 1022/19, 1125/19). Die Strafverfolgungsbehörden können sich jedoch nicht darauf zurückziehen, die anwaltliche Tätigkeit im Rahmen von Internal Investigations gehöre nicht zum Kernbereich des Anwaltsprivilegs. Dies geht zum einen an beraterischen Realitäten vorbei und beschneidet zum anderen die Verteidigungsrechte von Unternehmen in bedenklichem Maße. Damit besteht weiterhin dringender Reformbedarf.
Fazit
Es bleibt abzuwarten, welche der Forderungen sich realpolitisch tatsächlich umsetzen lassen und welchen Weg die Rechtspolitik einschlagen wird. In der vergangenen Wahlperiode fand mit den Vorhaben einer Reform der StPO, der Einführung einer digitalen Dokumentation der Hauptverhandlung und der Entkriminalisierung von Straftatbeständen erstmals seit Jahren wieder eine mehr auf Freiheitsrechten orientierte Strafrechtspolitik statt. Die Wahlprogramme lassen einen solchen Fortgang für die nächste Wahlperiode nicht unbedingt vermuten: Gerade bezüglich der Verschärfung des Vermögensabschöpfungs- sowie des Geldwäscherechts ist über die Parteilager hinweg grundsätzlich ein breiter Konsens festzustellen, sodass Reformen hier besonders nahe liegen. Die Entwicklung des Unternehmensstrafrecht ist vor diesem Hintergrund völlig offen.
In jedem Fall sollte der Gesetzgeber auch zukünftig das Ultima-Ratio-Prinzip im Strafrecht nicht aus den Augen verlieren, eine stärker evidenzbasierte Kriminalpolitik verfolgen und im Unternehmensstrafrecht eine rechtssichere Förderung von Compliance ins Zentrum weiterer Erwägungen stellen.