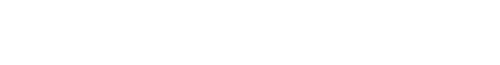OLG Bremen: Zwangsweise Smartphone-Entsperrung mittels Fingerabdrucks zulässig
Mit dem Beschluss des OLG Bremen vom 8.1.2025 (1 ORs 26/24) liegt erstmals eine obergerichtliche Entscheidung zu der Frage vor, ob das Entsperren eines Smartphones gegen den Willen des Beschuldigten durch Auflegung seines Fingers auf den Fingerabdrucksensor zulässig ist.
Der Fall
Im zugrunde liegenden Fall wurde die Wohnung des Angeklagten wegen des Verdachts einer Straftat durchsucht. Im Rahmen der Durchsuchung wurde das durch einen Fingerabdruckscanner gesperrte Mobiltelefon des Angeklagten aufgefunden. Nachdem der Angeklagte der Aufforderung zur Entsperrung des Geräts nicht nachkam, wurde er darüber belehrt, dass die Entsperrung andernfalls unter Anwendung unmittelbaren Zwangs durchgeführt werde. Nachdem der Angeklagte zu flüchten versuchte und daraufhin durch einen Polizeibeamten zu Boden gebracht und fixiert wurde, wurde der Finger des Angeklagten gegen seinen Willen auf den Fingerabdrucksensor des Mobiltelefons aufgelegt, um dieses zu entsperren.
Aufgrund der Gegenwehr wurde der Angeklagte in erster Instanz wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte (§ 113 StGB) zu einer Geldstrafe verurteilt. Da auch die eingelegte Berufung erfolglos war, hat der Angeklagte schließlich Revision zum OLG Bremen eingelegt.
Die Entscheidung des OLG Bremen
Das OLG Bremen hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen und vertritt die Auffassung, dass es rechtmäßig sei, einem Beschuldigten zwangsweise Fingerabdrücke zwecks Entsperrung eines Mobiltelefons abzunehmen.
Damit schließt sich das OLG der bisher in der untergerichtlichen Rechtsprechung (vgl. LG Ravensburg, NStZ 2023, 446 und AG Baden-Baden, BeckRS 2019, 66684) vertretenen Ansicht an, wonach die Entsperrung elektronischer Geräte mittels biometrischer Daten auf die Ermächtigungsgrundlage in § 81b Abs. 1 StPO gestützt werden könne. Danach dürfen Lichtbilder und Fingerabdrücke eines Beschuldigten auch gegen seinen Willen aufgenommen und Messungen und ähnliche Maßnahmen an ihm vorgenommen werden, soweit es für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens oder für die Zwecke des Erkennungsdienstes notwendig ist.
Die Entsperrung eines Mobiltelefons mittels erzwungenen Auflegens des Fingers des Beschuldigten auf einen Sensor sei hier nicht ausdrücklich genannt, jedoch habe der Gesetzgeber die Norm bewusst technikoffen formuliert, sodass dies als „ähnliche Maßnahme“ im Sinne der Vorschrift zu verstehen sei, die der ebenfalls erfassten Aufnahme von Fingerabdrücken nahekomme. Die Entsperrung sei gegenüber der Fingerabdruckaufnahme sogar weniger eingriffsintensiv, da es sich lediglich um eine einmalige Verwendung der Daten ohne anschließende Speicherung handele. En passant merkte das OLG zudem an, dass für die Entsperrung mittels Gesichtserkennung (sog. Face-ID) oder eines Irisscans ähnliches gelten würde, denn diese Maßnahmen seien mit der in § 81b Abs. 1 StPO genannten Lichtbildaufnahme vergleichbar.
Der Subsumtion unter § 81b Abs. 1 StPO stehe auch nicht die Überschrift „Erkennungsdienstliche Maßnahmen bei dem Beschuldigten“ entgegen, da der Normwortlaut Maßnahmen nicht nur zum Zwecke des Erkennungsdienstes (Alt. 2) zulasse, sondern auch generell „für die Zwecke der Durchführung des Strafverfahrens“ (Alt. 1). Eine Beschränkung der Ermächtigung auf Maßnahmen zur Registrierung von „für die Individualität einer Person signifikante dauerhafte Persönlichkeitsgegebenheiten“ zur Feststellung der Tätereigenschaft des Beschuldigten sei weder der Regelung selbst noch ihrer Historie zu entnehmen. Auf dieser Grundlage sei darum auch die Vermessung individueller körperlicher Merkmale des Beschuldigten zu sonstigen Zwecken der Durchführung des Strafverfahrens möglich.
Darüber hinaus verstoße das Vorgehen der Polizei auch nicht gegen den Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit, denn der Angeklagte habe das Auflegen seines Fingers lediglich passiv dulden müssen – verboten sei lediglich vor dem Zwang zur aktiven Mitwirkung an der eigenen Strafverfolgung.
Ebenso sei weder eine Verletzung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung noch des Grundrechts auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme anzunehmen, die sich beide aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ableiten lassen. § 81b Abs. 1 StPO sei eine hinreichende Grundlage für die offene Ermittlung und den damit einhergehenden nur geringinvasiven Eingriff in diese Grundrechte. Das Gericht betonte dabei, dass der Eingriff durch das zwangsweise Entsperren mittels Fingerabdrucks und der Zugriff auf die im Telefon gespeicherten Daten sowie deren Durchsicht voneinander zu trennen seien – der Datenzugriff sei nach §§ 94, 110 StPO separat zu beurteilen.
Das Gericht kam damit zu dem Schluss, dass die Maßnahme aufgrund des weitgehenden Ermächtigungsrahmens von § 81b Abs. 1 StPO alleine auf ihre Verhältnismäßigkeit zu prüfen sei, wobei dies im vorliegenden Fall bejaht werden könne. Insbesondere sei die Maßnahme erforderlich und angemessen gewesen, denn das zwangsweise Auflegen des Fingers sei weniger eingriffsintensiv als andere Maßnahmen, wie etwa die Anfertigung und Speicherung des Fingerabdrucks zur Erstellung einer Fingerabdruck-Attrappe, und der Eingriff in die persönliche Freiheit des Beschuldigten sei im Übrigen nur von kurzer Dauer und einer geringen Intensität gewesen.
Eigene Bewertung
Die Entscheidung des OLG Bremen stärkt die Position der Strafverfolgungsbehörden und beschneidet die Rechte der Beschuldigten, indem es tiefgreifende Ermittlungseingriffe als rechtmäßig bewertet. Das Gericht verkennt jedoch sowohl die Bedeutung der betroffenen Grundrechte des Beschuldigten als auch den Anwendungsbereich von § 81b Abs. 1 StPO.
Die zwangsweise Entsperrung des Telefons durch biometrische Daten des Beschuldigten stellt einen deutlich schwerwiegenderen Grundrechtseingriff dar als es das Gericht annimmt. Das OLG Bremen attestiert der Maßnahme fälschlicherweise nur eine „geringe Eingriffstiefe“, denn anders als im klassischen Fall des § 81b Abs. 1 StPO erfolge keine dauerhafte Speicherung des Fingerabdrucks. Bei dem Auflegen des Fingers auf den Sensor eines Mobiltelefons handle es sich stattdessen bloß um eine Vermessung zur einmaligen Verwendung. Ohne Berücksichtigung bleibt hierbei aber, dass der Fingerabdruck als „Schlüssel“ zu einer Vielzahl von mitunter intimen Daten dient, an deren Vertraulichkeit eine Person regelmäßig ein größeres Interesse haben wird als an der Geheimhaltung ihres Fingerabdrucks. Es ist zwar korrekt, dass die digitalen Daten nicht bereits durch das Entsperren des Smartphones, sondern erst durch ihre Auswertung unmittelbar betroffen sind, doch darf diese Differenzierung nicht dazu führen, dass bei der Bewertung der Eingriffstiefe der Grund des Eingriffs gänzlich außen vor bleibt.
Mit Blick auf den Zweck der Maßnahme ist bereits fragwürdig, ob die Heranziehung der Fingerabdrücke des Beschuldigten als Schlüssel überhaupt einen Zweck darstellt, der von § 81b Abs. 1 StPO gedeckt ist. Das Gericht verkennt, dass eine Maßnahme nach § 81b Abs. 1 StPO einen spezifischen Zweck verfolgen muss. Strafprozessuale Maßnahmen knüpfen an bestimmte Ermittlungsziele, zu deren Verwirklichung sie ergriffen werden dürfen. Im Fall von § 81b Abs. 1 StPO liegt das Ermittlungsziel darin, Zweifel an der Person des Beschuldigten oder deren persönlicher Beziehung zur Außenwelt zum Zwecke des Tatnachweises auszuräumen – der Fingerabdruck, die Lichtbildaufnahme oder die körperliche Messung muss damit einen Bezug zur individuellen Identifikation des Beschuldigten bzw. ihrer Zuordnung zu einem Geschehen haben, um auf Grundlage von § 81b Abs. 1 StPO erfolgen zu dürfen. Eine Ermittlungsgrundlage, die die Nutzung des Fingerabdrucks als „Schlüssel“ zu einem Datenspeicher erlaubt, wäre stattdessen im achten Abschnitt („Ermittlungsmaßnahmen“) und dort bei den §§ 94 ff., 110 ff. StPO zu erwarten, die die Beschlagnahme und Durchsicht von Daten behandeln. Daher wird in der Literatur teilweise vertreten, dass eine Smartphone-Entsperrung durch Verwendung biometrischer Merkmale nur in bestimmten Fällen auf § 81b Abs. 1 StPO gestützt werden kann, nämlich wenn die Maßnahme eine Identifikationskomponente aufweist. Dies ist sei etwa der Fall, wenn durch die Entsperrung geprüft werden soll, ob der Beschuldigte der Besitzer des Smartphones ist oder nicht (Horter, NStZ 2023, 446, 447).
Schließlich ist fraglich, ob dem Gericht zumindest insoweit zugestimmt werden kann, wie es die Selbstbelastungsfreiheit des Beschuldigten für nicht betroffen angesehen hat. Das Argument des Gerichts, dass die Maßnahme keine aktive Mitwirkung des Beschuldigten erfordert habe, trifft zwar zu, doch würde dies auch bedeuten, dass der Schutz digitaler Daten vor staatlichen Zugriffen davon abhängt, ob der Betroffene zufällig einen Passwortschutz gewählt hat oder ein biometrisches Authentifizierungsmerkmal nutzt.
Fazit und Ausblick
Im Ergebnis ist dem OLG Bremen damit zu widersprechen: § 81b Abs. 1 StPO stellt keine taugliche Ermächtigung für die Entsperrung eines Mobiltelefons durch Auflegen des Fingers eines Beschuldigten auf den Fingerabdrucksensor dar. Vor dem Hintergrund der erheblich eingeschränkten Grundrechte wäre eine spezifische Ermächtigungsgrundlage in der StPO erforderlich, die es bisher jedoch nicht gibt. Insofern wäre eine Nachbesserung durch den Gesetzgeber geboten. Dies gilt umso mehr, wenn man sich vor Augen führt, welche Bedeutung das Smartphone in der heutigen Welt als Beweismittel im Strafverfahren innehat. Es bleibt abzuwarten, ob sich weitere Obergerichte der Entscheidung des OLG Bremen anschließen werden.