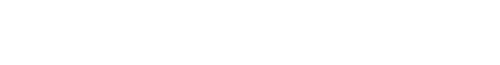Strafrechtliche Risiken bei einem Verstoß gegen das Abspracheverbot zwischen DiGA-Herstellern und der Pharma- und Hilfsmittelindustrie
Am 26. März 2024 wurde ein Abspracheverbot zwischen DiGA-Herstellern und Herstellern von Arzneimitteln oder Hilfsmitteln in § 33a Abs. 5a SGB V aufgenommen. Es tritt neben die strengen Zuweisungs- und Kooperationsverbote zwischen DiGA-Herstellern und Ärzten aus § 33a Abs. 5 SGB V. Mit § 33a Abs. 5a SGB V ist ein weiterer Teil des Lebenszyklus einer DiGA erfasst. Gerade DiGA-Startups und ihre Kooperationspartner aus der Pharma- und Hilfsmittelindustrie sollten das Verbot bei der Ausgestaltung ihrer Kooperation berücksichtigen. Bestehende Kooperationen sollten ihre Rechtmäßigkeit prüfen. Verstöße gegen das neu eingefügte Abspracheverbot können im Einzelfall zu einer Strafbarkeit der Beteiligten führen.
Das Abspracheverbot
Das Abspracheverbot ist in § 33a Abs. 5a SGB V geregelt. Es richtet sich an Hersteller digitaler Gesundheitsanwendungen sowie Hersteller von Arzneimitteln oder Hilfsmitteln. Sie dürfen untereinander weder Rechtsgeschäfte vornehmen noch Absprachen treffen, die geeignet sind, die Wahlfreiheit der Versicherten oder die ärztliche Therapiefreiheit bei der Auswahl der Arzneimittel oder Hilfsmittel zu beschränken. Damit setzt der Gesetzgeber unmittelbar an der Konzeption der DiGA an. Es ist unzulässig, die DiGA in einer Art und Weise auszugestalten, dass sie nur zur Begleitung einer Therapie mit einem bestimmten Arznei- oder Hilfsmittel geeignet ist. Erfasst sind alle Vorgehensweisen, die gezielt darauf gerichtet sind, die Wahlfreiheit der Versicherten zu beschränken. Schließlich wird durch eine solche Vorgehensweise eine Anwendung mit anderen geeigneten oder sogar besser geeigneten Hilfsmitteln oder Arzneimitteln bewusst unmöglich gemacht (sog. Lock-in-Effekte). Gemäß dem Wortlaut der Norm ist die Ausgestaltung der Beziehung der Hersteller irrelevant. Sie kann vertraglich abgesichert sein oder auf entsprechenden Abreden oder abgestimmten Verhaltensweisen beruhen. Entscheidend ist lediglich, dass der Zweck des gemeinsamen Vorgehens dem Inhalt nach oder aufgrund seiner faktischen Auswirkung dazu führt, dass ausschließlich bestimmte Kombinationen von Leistungen abgegeben werden können.
Wenig klare Worte findet der Gesetzgeber in der Begründung dafür, welche Kooperation überhaupt noch zulässig sein soll. Dort heißt es lediglich: „Eine bloße Übernahme eines Herstellers digitaler Gesundheitsanwendungen durch einen Hersteller von Arzneimitteln oder Hilfsmitteln erfüllt diese Anforderungen nicht“ (BT-Drs. 20/9048, S. 86). Hersteller von DiGAs sollten jedenfalls darauf achten, dass für eine nennenswerte Zahl der für das Anwendungsgebiet relevanten Arznei- oder Hilfsmittel die digitale Unterstützung möglich ist. Die DiGA muss nicht auf alle Arznei- oder Hilfsmittel des jeweiligen Anwendungsgebiets abgestimmt werden. Damit wird die Konzeptionsphase und die Konformitätsbewertung wirtschaftlich noch einmal deutlich anspruchsvoller für die Unternehmen.
Zielrichtung des Gesetzgebers
Der Gesetzgeber verfolgt mit dem Abspracheverbot unterschiedliche Zwecke. Zum einen soll die Norm dem individuellen Gesundheitsschutz der Versicherten dienen, indem ihre Wahlfreiheit und die ärztliche Therapiefreiheit gewahrt bleibt. Es besteht die Sorge, dass ansonsten nicht das bestgeeignetste Hilfs- oder Arzneimittel verordnet wird, sondern stattdessen eine Leistung, die eine digitale Unterstützung ermöglicht. Zum anderen will der Gesetzgeber die finanzielle Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Krankenversicherung absichern. Es sollen insoweit negative Kostenfolgen vermieden werden, indem andere gleichgeeignete – aber billigere – Hilfs- oder Arzneimittel ausgewählt werden können.
Strafrechtliche Folgen
Versicherte haben gemäß § 33a Abs. 1 SGB V einen leistungsrechtlichen Anspruch auf Versorgung mit digitalen Gesundheitsanwendungen, soweit sie
- vom BfArM in das Verzeichnis der erstattungsfähigen digitalen Gesundheitsanwendungen nach § 139e SGB V aufgenommen wurden und
- sie entweder
- nach ärztlicher Verordnung
- oder mit Genehmigung der Krankenkasse angewendet werden.
Der GKV-Spitzenverband vereinbart mit den DiGA-Herstellern mit Wirkung für alle Krankenkassen Vergütungsbeträge. Sie gelten nach dem ersten Jahr nach Aufnahme der DiGA in das Verzeichnis nach § 139e SGB V. Bis zur Festlegung der Vergütungsbeträge gelten die tatsächlichen Preise der DiGA-Hersteller. Nachdem eine DiGA ärztlich verordnet wurde, werden die Kosten dafür von der Krankenkasse direkt mit dem Hersteller abgerechnet, ohne dass eine Prüfung der medizinischen Indikation im Voraus erfolgt. Hier liegt auch das Einfallstor für die Strafbarkeiten der Beteiligten. Im Vordergrund stehen vor allem die klassischen Wirtschaftsdelikte, wenn man berücksichtigt, dass mit § 33a Abs. 5a SGB V die finanziellen Ressourcen der Krankenkassen geschützt werden sollen.
a. Betrugsrisiko für die DiGA-Hersteller
Die Rechtsprechung unterstellt, dass mit der Geltendmachung eines Zahlungsanspruchs zum Ausdruck gebracht werde, dass die Voraussetzungen der hierfür zugrundeliegenden (sozialrechtlichen) Rechtsvorschriften eingehalten wurden. Bei einem Verstoß gegen sozialrechtliche Vorschriften – wie zum Beispiel dem Abspracheverbot des § 33a Abs. 5a SGB V – wird der Zahlungsanspruch mit der streng formalen Betrachtungsweise auf 0 gesetzt. Das gilt unabhängig davon, ob eine Indikation für die Verordnung vorlag. Erfolgt die Abrechnung trotzdem, ist davon auszugehen, dass die Staatsanwaltschaften eine Betrugsstrafbarkeit nach § 263 Abs. 1 StGB in den Blick nehmen werden.
b. Bestechlichkeit und Bestechung im Gesundheitswesen
Sofern Ärzte in das „Vertriebssystem“ eingespannt werden und ihnen ein materieller oder immaterieller Vorteil dafür zufließt, dass sie die DiGA anstelle von anderen Hilfsmitteln verordnen, kommt auf Seiten des DiGA-Herstellers eine Strafbarkeit wegen Bestechung im Gesundheitswesen nach § 299b Nr. 1 StGB in Betracht und als Spiegelbild auf Seiten des Arztes eine Strafbarkeit wegen Bestechlichkeit im Gesundheitswesen nach § 299a Nr. 1 StGB.
c. Untreue des verordnenden Arztes, Keine Untreue des DiGA-Herstellers
Vertragsärzte trifft eine Vermögensbetreuungspflicht hinsichtlich der gesetzlichen Krankenkassen. Sie müssen – auch bei der Verordnung von DiGAs – insbesondere das Wirtschaftlichkeitsgebot nach § 12 SGB V beachten. Verordnen sie eine DiGA, der eine Absprache mit einem Hilfsmittelhersteller oder Arzneimittelhersteller zugrunde liegt, obwohl sie wissen, dass es gleich effektive, aber kostengünstigere Hilfsmittel für die Beschwerden des Patienten gibt, besteht das Risiko einer Untreuestrafbarkeit nach § 266 Abs. 1 StGB. Schließlich können sie durch die Verordnung die Vermögen der gesetzlichen Krankenkassen belasten, ohne dass diese – wie z.B. bei sonstigen Hilfsmitteln – eine vorherige Entscheidung über die Indikation treffen. Anders dürfte dies in der Variante sein, in der Patienten sich mit einer Genehmigung an die Kasse wenden.
Demgegenüber dürfte die DiGA-Hersteller keine Vermögensbetreuungspflicht hinsichtlich der gesetzlichen Krankenkassen treffen. Eine Untreue ist nicht möglich. Je nach Absprachen mit dem Vertragsarzt kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass Staatsanwaltschaften eine Anstiftung oder Beihilfe für möglich halten.
Geringe Hürden für die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
Die Hürden für die Einleitung eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens wegen dieser Delikte sind gering. Es reicht das Vorliegen eines Anfangsverdachts aus. Hierunter versteht man, dass aufgrund bestimmter Tatsachen nach kriminalistischer Erfahrung die Möglichkeit besteht, dass Straftaten begangen wurden. Oft reicht schon die Behauptung eines Patienten oder eines Wettbewerbers aus, dass eine unzulässige Absprache vorliegt. Anonyme Anzeigen können unter bestimmten Umständen sogar auch ausreichen. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie wegen dieser Delikte eine Ladung zur Beschuldigtenvernehmung erhalten. Wir verteidigen Sie in allen strafrechtlichen Instanzen.
Prävention
Auch wenn man das Risiko eines Ermittlungsverfahrens nie ganz ausschließen kann, kann man dieses durch bestimmte Maßnahmen deutlich reduzieren. Die vorbenannten Delikte sind allesamt Vorsatzdelikte. Ein starkes Argument gegen vorsätzliches Handeln liegt in dem ernstgemeinten Bemühen, die sozialrechtlichen Vorgaben einzuhalten. Dies gilt sowohl für den Vertragsschluss als auch dessen dauerhafte praktische Ausgestaltung. Es ist sinnvoll, geplante Kooperationen vorab anwaltlich auf eine Übereinstimmung mit dem Abspracheverbot des § 33a Abs. 5a SGB V prüfen zu lassen. Dadurch entkräftet man den in Ermittlungsverfahren immer wiederkehrenden Vorwurf, dass die Kooperation von Beginn an mit krimineller Energie betrieben wurde. Die Vorgaben sollten Start-Ups auch schon bei Konzeption ihrer App berücksichtigen. Darüber hinaus zeigt die Schaffung von internen Verhaltensrichtlinien und Vorgaben (Compliance-Systeme) sowie die Überwachung der Einhaltung dieser Vorgaben, dass auch die gelebte Praxis der Kooperation nicht auf einen bewussten Verstoß angelegt war. Wir unterstützen Sie gerne mit der Begutachtung von geplanten Kooperationsmodellen und der Etablierung von robusten Criminal-Compliance-Systemen für die gesamte Lebensdauer der Kooperation.