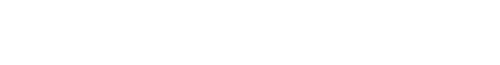Strafrecht im Koalitionsvertrag 2025 – Was plant die Koalition?
CDU/CSU und SPD haben letzte Woche eine Einigung über den gemeinsamen Koalitionsvertrag für die 21. Legislaturperiode erzielt. Der 146 Seiten starke Vertrag enthält auch viele strafrechtliche bzw. strafprozessuale Themen, die im Folgenden überblicksartig beleuchtet werden sollen.
- Strafverfahrensrecht
Grundlegende Überarbeitung des Strafverfahrensrechts
In den letzten Jahren haben punktuelle Reformen des Strafverfahrensrechtsdazu geführt, dass die StPO ihren eigenen Grundsätzen und Zielen an einigen Stellen nicht mehr gerecht wird. Daher ist es begrüßenswert, dass der Koalitionsvertrag an der „Wurzel des Problems“ ansetzt und eine grundlegende Überarbeitung der StPO vorsieht.
Für die genaue Ausarbeitung der Reform soll eine Kommission aus Wissenschaft und Praxis unter Beteiligung der Länder eingesetzt werden. Dabei ist es wichtig, innerhalb der Kommission eine angemessene Repräsentation der Anwaltschaft zu gewährleisten. Andernfalls droht, insbesondere unter Berücksichtigung der im Koalitionsvertrag formulierten Ziele (Gewährleistung von effektiver und zügiger Strafverfolgung, Verbesserung des Opferschutzes), eine weitere Beschränkung von Beschuldigtenrechten.
Erweiterung der §§ 100a ff. StPO und digitaler Befugnisse
Der Koalitionsvertrag sieht vor, die behördlichen Befugnisse an technische Realitäten anzupassen. Insbesondere soll die rechtspolitisch sehr umstrittene Vorratsdatenspeicherung eingeführt werden; konkret: eine dreimonatige Speicherpflicht für IP-Adressen und Portnummern. Außerdem soll die Bundespolizei eine Ermächtigungsgrundlage für den Einsatz einer Quellen-TKÜ ohne Zugriff auf retrograde Daten erhalten. Darüber hinaus soll Sicherheitsbehörden der Einsatz automatisierter, auch KI-basierter, Datenanalysen erlaubt werden. Die Befugnis soll sich ebenfalls auf den nachträglichen biometrischen Abgleich mit öffentlich zugänglichen Internetdaten erstrecken – auch hier mittels KI. Die EU-KI-Verordnung steht dem nicht entgegen. Nachträgliche KI-gestützte Fernidentifizierungssysteme sind danach in deutlich weiterem Umfang zulässig als in Echtzeit operierende Systeme und im Wesentlichen an eine Genehmigung durch eine Justiz- oder Verwaltungsbehörde gebunden (Art. 26 Abs. 10 UAbs. 1 KI-VO). Eine solche Genehmigung ist jedoch entbehrlich, wenn der Einsatz der erstmaligen Identifizierung des Betroffenen gilt. Jedenfalls eine „ungezielt“ suchende Web-Scraping-KI wäre demnach unzulässig (Art. 5 Abs. 1 UAbs. 1 lit. e KI-VO).
Auch den Strafverfolgungsbehörden soll zukünftig im Einzelfall die retrograde biometrische Fernidentifizierung zur Identifizierung von Tätern ermöglicht werden. Da sich diese Maßnahme in einem sehr grundrechtssensiblen Bereich bewegt, ist hier in besonderem Maße gesetzgeberisches Fingerspitzengefühl gefragt. Dessen scheinen sich die Vertragsparteien grundsätzlich auch bewusst zu sein, da sie die Maßnahmen nur unter engen Voraussetzungen und bei schweren Straftaten zulassen wollen. Zudem soll auch der Einsatz automatisierter Kennzeichenerfassungssysteme im Aufzeichnungsmodus zu Strafverfolgungszwecken geregelt werden.
In Bezug auf die §§ 100a ff. StPO ist geplant, deren Straftatenkataloge „soweit erforderlich“ (Z. 2838 f.) auszuweiten. Der genaue Umfang der Erweiterung bleibt dabei unklar. Geplant ist aber jedenfalls, die Geldwäsche als solche als Katalogtat aufzunehmen. Aktuell sind die §§ 100a ff. StPO bei § 261 StGB nur dann anwendbar, wenn die Vortat, an welche die Geldwäsche anknüpft, ihrerseits eine Katalogtat darstellt (§ 100a II Nr. 1 lit. m StPO). Diese Erweiterung hat Sprengkraft, gilt doch § 261 StGB bereits seinerseits spätestens seit Einführung des „all-crimes-Ansatzes“ als bedenklich weit. Darüber hinaus soll die Telefonüberwachung beim Wohnungseinbruchsdiebstahl entfristet werden.
- Materielles Strafrecht
Modernisierung des Strafrechts
In materieller Hinsicht stellt der Koalitionsvertrag unter anderem eine Modernisierung des StGB in Aussicht. Dabei wird insbesondere geprüft, welche Straftatbestände überflüssig sind und gestrichen werden können. Hierbei kann in großem Umfang an die Vorarbeit des BMJ unter der Ampel-Regierung zur Streichung und Modernisierung überholter Tatbestände angeknüpft werden, deren Erkenntnisse die FDP-Fraktion Ende 2024 mit einem Gesetzentwurf in den Bundestag eingebracht hat. Dieser Entwurf sah insbesondere eine Reform des § 142 StGB (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) sowie die Streichung des § 265a I Var. 3 StGB (Erschleichen von Leistungen) vor. Ersatzlos gestrichen werden sollten danach beispielsweise auch § 290 StGB (Unbefugter Gebrauch von Pfandsachen), § 316a StGB (Räuberischer Angriff auf Kraftfahrer) sowie § 323b StGB (Gefährdung einer Entziehungskur).
Schutz von Rettungskräften, Polizisten und anderen für das Allgemeinwohl tätigen Personen
Der strafrechtliche Schutz von Einsatz- und Rettungskräften, Polizisten sowie Angehörigen der Gesundheitsberufe soll künftig verschärft bzw. verbessert werden. Zusätzlich sollen entsprechende Strafverfahren beschleunigt werden (Z. 3792 f.), wobei der genaue Weg dorthin unklar bleibt. Weiterhin wird geprüft, ob auch ein erweiterter Schutz für Kommunalpolitiker sowie für das Allgemeinwohl Tätige geboten ist. Diese Maßnahmen stehen ganz im Zeichen jüngerer Verschärfungen zum Schutz jener Personengruppen (§§ 188, 323c II StGB), wobei stets kritisch zu hinterfragen ist, ob nicht die konsequente Durchsetzung des bereits bestehenden Regelungssystems ausreicht.
Fokus auf Terrorismus und politischen Straftaten
Die Vertragsparteien sprechen sich im Koalitionsvertrag für ein verstärktes Vorgehen gegen Terrorismus und politische Straftaten aus. So soll mit den Ländern eine Strategie zur wirksamen Verfolgung linksextremistischer Straftaten entwickelt werden. Mit der Erhöhung des Regelstrafrahmens in § 99 I StGB auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren sollen geheimdienstliche Agententätigkeiten zulasten der Bundesrepublik Deutschland härter bestraft werden. In Reaktion auf vergangene Anschläge mit Alltagsgegenständen ist eine Erweiterung des § 89a StGB (Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat) für den Fall geplant, dass bei der Straftat Gegenstände wie Messer oder Pkws eingesetzt werden sollen.
Des Weiteren ist eine Verschärfung des Volksverhetzungstatbestands (§ 130 StGB) geplant. Bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung soll künftig auch der Entzug des passiven Wahlrechts möglich sein. Zudem soll geprüft werden, ob ein Straftatbestand für Amtsträger und Soldaten eingeführt wird, die im Zusammenhang mit ihrer Dienstausübung in geschlossenen Chatgruppen antisemitische oder extremistische Hetze teilen.
Umweltkriminalität
Der Koalitionsvertrag geht davon aus, dass es sich bei Umweltkriminalität um ein wesentliches Betätigungsfeld organisierter Kriminalität handelt und entsprechende Bekämpfungsstrategien erforderlich sind. Dafür wollen die Vertragsparteien einen nationalen Aktionsplan für die Bekämpfung von Umweltkriminalität ausarbeiten, wobei in Anbetracht der typischerweise grenzüberschreitenden Dimensionen von Umweltdelikten eine verstärkte europäische und internationale Zusammenarbeit geplant ist.
Reform der Vermögensabschöpfung
Wie bereits im Wahlprogramm von CDU/CSU gefordert, ist auch nach dem Koalitionsvertrag künftig eine vollständige Beweislastumkehr für Vermögen unklarer Herkunft geplant. Bei der Verschärfung des § 76a IV StGB soll dem Vermögensinhaber der Beweis obliegen, dass sein Vermögenswert aus legalen Quellen stammt; gelingt ihm dieser Beweis nicht, kann der Vermögenswert eingezogen werden. Diese Beweislastumkehr wurde zwischen CDU/CSU und SPD bereits im Koalitionsvertrag zur 18. Legislaturperiode vereinbart, jedoch nie verwirklicht. Es ist bereits fraglich, ob eine vollständige Beweislastumkehr rechtstechnisch überhaupt geboten ist. So lehnen sich die Beweisregeln nach § 437 StPO ohnehin an die des Zivilverfahrens an und ein grobes Missverhältnis zwischen dem Wert eines Vermögenswertes und den rechtmäßigen Einkünften des Betroffenen kann bereits durch das Gericht berücksichtigt werden. Ungeachtet dessen bestehen bezüglich einer vollständigen Beweislastumkehr erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken.
Weiter ist geplant, die 2024 veröffentlichten Empfehlungen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Optimierung des Rechts der Vermögensabschöpfung umzusetzen. Die Empfehlungen betreffen das Abschöpfungsrecht in ganz unterschiedlichen Facetten und sollen primär das Abschöpfungsverfahren vereinfachen, Abschöpfungslücken schließen sowie teilweise auch Betroffenen- und Geschädigtenrechte stärken. Ob die Empfehlungen vollständig umgesetzt werden sollen oder Abweichungen im Detail vorgesehen sind, bleibt im Koalitionsvertrag unklar.
Änderungen im Cyberstrafrecht
Im Bereich des Cyberstrafrechts sollen zum einen Strafbarkeitslücken geschlossen werden, z. B. bei bildbasierter sexualisierter Gewalt. In diesem Kontext sollen auch Deep Fakes ins Visier genommen werden und deren Zugänglichmachung gegenüber Dritten pönalisiert werden. Zum anderen soll für IT-Sicherheitsforschende eine rechtssichere Arbeitsgrundlage geschaffen werden. Die §§ 202a ff., 303a f. StGB und insbesondere der sog. „Hackerparagraph“ § 202c StGB bedingen für die IT-Sicherheitsforschung gewisse Strafbarkeitsrisiken. Auch hier kann auf Vorarbeiten aus der vorangegangenen Legislaturperiode in Form eines Referentenentwurfes des BMJ zurückgegriffen werden.
Zudem ist vorgesehen, schärfere Sanktionsmöglichkeiten für Betreiber von Plattformen zu schaffen, die strafbare Inhalte nicht ordnungsgemäß entfernen. Weiter setzen sich die Koalitionäre für die Schaffung eines „digitalen Gewaltschutzgesetzes“ ein. Anonyme Hass-Accounts mit deliktischen Inhalten sollen danach zukünftig gesperrt werden können. Zudem müssen Plattformen Schnittstellen für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden schaffen, sodass ein automatischer und zügiger Datenabruf möglich ist.
Schutz von Frauen und besonders vulnerabler Personengruppen
§ 211 StGB soll um ein neues Mordmerkmal zum Schutz von Frauen und besonders verletzlichen Personengruppen wie Kindern, gebrechlichen Menschen oder Menschen mit Behinderung ergänzt werden. Wie dieses Mordmerkmal genau ausgestaltet wird, bleibt offen. In Anbetracht der Vielzahl bislang erfolgloser Reformansätze des Mordparagraphen dürfte hier noch viel Diskussionsarbeit vor den Parteien liegen. Ob entsprechende Qualifikationsmerkmale auch bei der gefährlichen Körperverletzung nach § 224 StGB und dem schweren Raub nach § 250 StGB geboten sind, soll noch geprüft werden. Weiterhin ist geplant, den Nachstellungstatbestand (§ 238 StGB) auf die Nutzung von GPS-Trackern zu erweitern und insgesamt zu verschärfen. Änderungen sind auch im Gewaltschutzgesetz geplant, wo die Strafandrohung bei Verstößen erhöht, und eine Rechtsgrundlage für die gerichtliche Anordnung einer elektronischen Fußfessel und für verpflichtende Anti-Gewalt-Trainings geschaffen werden soll. Auch für Gruppenvergewaltigungen sind härtere Strafen geplant.
Darüber hinaus ist eine Prüfung vereinbart, ob eine gefährliche Körperverletzung mittels einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs (§ 224 I Nr. 2 StGB) und mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung (§ 224 I Nr. 5 StGB) künftig als Verbrechen ausgestaltet werden soll. § 224 StGB sieht jedoch bereits einen Strafrahmen von Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor, der eine sachgerechte Ahndung schon jetzt ermöglicht. Bei einer Ausgestaltung als Verbrechen muss beachtet werden, dass dies den Strafverfolgungsbehörden in der Konsequenz die Flexibilität nehmen würde, das Verfahren z.B. nach § 153a StPO einzustellen. Zum anderen bestünden erhöhte Hürden für eine Aussetzung der Strafvollstreckung zur Bewährung.
Verschärfung des Ausweisungsrechts
Begehen Personen, die einer Aufenthaltserlaubnis bedürfen, nicht unerhebliche Straftaten, soll dies zukünftig regelmäßig zu einer Ausweisung aus der Bundesrepublik Deutschland führen. Geplant ist diese Nebenfolge insbesondere bei Straftaten gegen Leib und Leben, gegen die sexuelle Selbstbestimmung, bei Volksverhetzung, bei antisemitisch motivierten Straftaten ebenso wie bei Widerstand oder tätlichen Angriffen gegen Vollstreckungsbeamte.
Härtere Strafen bei Verletzung der Unterhaltspflicht
Durch eine Strafverschärfung des § 170 StGB (Verletzung der Unterhaltspflicht), z. B. durch „Führerscheinentzug“ (Z. 3172 f.), versprechen sich die Parteien eine höhere Rückgriffquote beim Unterhaltsvorschuss. Ob dies durch eine Strafverschärfung wirklich erreicht werden kann, dürfte kontrovers diskutiert werden.
- Weitere Vorhaben mit strafrechtlichem Bezug
Durchsetzung des Außenwirtschaftsrechts
Bei der Durchsetzung des Außenwirtschaftsgesetzes streben die Parteien eine neue Herangehensweise an. Ausfuhrgenehmigungsprozesse sollen künftig vereinfacht und beschleunigt werden. Dazu sind anstelle von durchgängigen Prüfungen nunmehr stichprobenartige Überprüfungen in Verbindung mit empfindlichen Strafen vorgesehen. Die damit verbundene Verfahrensbeschleunigung ist durchaus begrüßenswert. Ob das veränderte Präventionsmodell praktischen Bedürfnissen umfassend gerecht wird, wird sich zeigen.
Verstöße gegen Mietwuchervorschriften und die Mietpreisbremse
Im Kampf gegen steigende Mietpreise ist eine Reform der Mietwuchervorschriften sowie eine Bußgeldbewehrung bei Verstößen gegen die Mietpreisbremse geplant. Dabei bleibt abzuwarten, wie die Reform der Mietwucherregeln genau ausgestaltet wird. Dass § 5 WiStG 1954 praktischen Bedürfnissen nicht gerecht wird und daher reformbedürftig ist, ist seit langem anerkannt. Die große Koalition hat daher bereits in der 18. Legislaturperiode einen Gesetzentwurf zur Änderung der Vorschrift in den Bundestag eingebracht (vgl. BT-Drs. 18/3121, S. 14 f., 47), der sich letztlich jedoch nicht durchsetzen konnte.
Abschaffung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes
Im Rahmen eines nationalen „Sofortprogramms für den Bürokratierückbau“ ist insbesondere die Abschaffung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG) geplant. Es soll durch ein neues Gesetz ersetzt werden, das die Europäische Lieferkettenrichtlinie (CSDDD) bürokratiearm und vollzugsfreundlich umsetzt. Die aktuell gültigen Sorgfaltspflichten nach dem LkSG sollen laut Koalitionsvertrag bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes, mit Ausnahme von massiven Menschenrechtsverletzungen, nicht sanktioniert werden. Bislang sieht § 24 LkSG für Verstöße einen umfangreichen Bußgeldkatalog vor.
Fazit
Der Koalitionsvertrag enthält eine Vielzahl straf- und verfahrensrechtlicher Vorhaben. Gerade die umfassende Reform der StPO ist ein äußerst ambitioniertes Projekt und muss weiter beobachtet werden. Bedenklich erscheint jedoch der Grundtenor des Vertrages, der fast durchweg Verschärfungen und Ausweitungen enthält und lediglich in Bezug auf die Modernisierung des StGB die Streichung einiger (ohnehin nicht praktisch relevanter) Tatbestände in Aussicht stellt, womit sich der Koalitionsvertrag einem zunehmenden „Law-and-order-Klima“ anpasst. Strafrechtstheoretisch darf auch bei künftigen Reformen das Ultima-ratio-Prinzip nicht aus den Augen verloren werden, während aus kriminologischer Sicht im Einzelfall kritisch geprüft werden muss, ob die Verschärfungen tatsächlich auf einer evidenzbasierten Grundlage fußen.
Interessant ist auch, an welchen Stellen auf eine abschließende inhaltliche Positionierung verzichtet wird. Gerade bei rechtspolitisch sehr umstrittenen Themen wie der Rücknahme der Cannabislegalisierung, der Pönalisierung des „Catcallings“ oder der Reform des Jugendstrafrechts (insbesondere wohl auch der Strafmündigkeitsgrenze) wurde im Koalitionsvertrag lediglich vereinbart, die Reformbedürftigkeit zu prüfen. Im Ergebnis ist es zu begrüßen, dass von vorschnellen Festlegungen Abstand genommen wurde, zumal Koalitionsverträge ohnehin nur grobe rechtspolitische Segelanweisungen enthalten können.