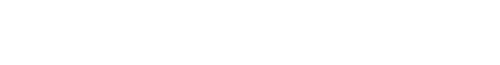EuGH stellt Bußgeldkonzept des EDPB in Frage: Eine Analyse der Entscheidung C-383/23
Die jüngste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in der Rechtssache C-383/23 hat weitreichende Auswirkungen auf die Berechnung von Bußgeldern nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Diese Entscheidung ist besonders relevant für Verteidiger, Unternehmensjuristen und Leiter von Rechtsabteilungen, die sich mit der Einhaltung von Datenschutzvorschriften und der Verteidigung gegen Bußgelder auseinandersetzen müssen. Der EuGH hat klargestellt, dass die Berechnung des maximalen Bußgeldrahmens zwar auf Basis des kartellrechtlichen Unternehmensbegriffs erfolgen kann. Die konkrete Bußgeldhöhe darf jedoch nicht jedoch nicht auf dieser Grundlage festgelegt darf. Diese Entscheidung stellt das Bußgeldkonzept des Europäischen Datenschutzausschusses (EDPB) grundsätzlich in Frage. Sie eröffnet zudem neue Verteidigungsansätze für Unternehmen gegen Geldbußen nach Art. 83 DSGVO.
- Hintergrund der Entscheidung
Der EuGH musste klären, ob der kartellrechtliche Begriff des „Unternehmens“ bzw. der wirtschaftlichen Einheit im Sinne der Artikel 101 und 102 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) auch für die Berechnung von Bußgeldern nach Artikel 83 DSGVO herangezogen werden kann. Der Gerichtshof bestätigte, dass der maximale Bußgeldrahmen auf Basis des Umsatzes des gesamten Konzerns berechnet werden kann.
Bei der Festlegung des maximalen Bußgelds soll danach der Umsatz der gesamten wirtschaftlichen Einheit berücksichtigt werden können. Das ist insbesondere für große und umsatzstarke Unternehmensgruppen von Bedeutung. Die Datenschutzbehörden dürfen den Umsatz der wirtschaftlichen Einheit bei der Festlegung der konkreten Bußgeldhöhe im Einzelfall jedoch nur dann berücksichtigen, wenn es darum geht zu überprüfen, ob die Geldbuße hinreichend wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist.
- Unterschiede zum EDPB-Bußgeldkonzept
Das EDPB verfolgt mit seinem Bußgeldmodell einen grundlegend anderen Ansatz. Es zieht zunächst den Umsatz des Unternehmens bzw. der wirtschaftlichen Einheit (also oft der Konzernumsatz) als Basisgröße für die Bußgeldberechnung heran und berücksichtigt darauf aufbauend weitere Faktoren. Der EuGH hingegen fordert eine individuelle Bewertung der Tat und der Schuld des Unternehmens. Dies bedeutet, dass die spezifischen Umstände des Falls und die individuell vorgeworfene Schuld des Unternehmens im Vordergrund stehen sollten. Nur wenn die so ermittelte Geldbuße nicht ausreichend wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist, soll die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Unternehmens berücksichtigt werden.
- Kritische Betrachtung der EuGH-Entscheidung
Zwar muss die Entscheidung des EuGH in vielen Aspekten als fragwürdig angesehen werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich des Ansatzes einer strafverschärfenden Analogie ohne nähere Begründung. Dennoch bietet das Urteil wertvolle Ansätze für die Verteidigung von Unternehmen. Die Entscheidung ermöglicht es, nach dem EDPB-Konzept festgelegte Bußgelder inhaltlich anzugreifen und eine differenziertere Betrachtung der individuellen Umstände des Falls zu fordern.
- Verteidigungsstrategien für Unternehmen
- Individuelle Bewertung der Tat: Unternehmen sollten in laufenden Verfahren argumentieren, dass die Bußgeldhöhe stets auf der Grundlage der spezifischen Umstände des Falls und der individuellen Schuld bemessen ist. Dies erfordert eine gründliche Analyse und Dokumentation der internen Prozesse und der spezifischen Umstände, die zu dem Verstoß geführt haben.
- Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Die Verteidigung kann darauf gestützt werden, dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nur dann berücksichtigt werden sollte, wenn die Bußgeldhöhe nicht bereits wirksam, verhältnismäßig und abschreckend ist. Hierbei ist es wichtig, die finanzielle Situation des Unternehmens klar darzustellen und zu argumentieren, dass ein übermäßiges Bußgeld die wirtschaftliche Stabilität gefährden könnte.
- Angriff auf die EDPB-Methodik: Die Entscheidung des EuGH kann genutzt werden, um die Methodik des EDPB in Frage zu stellen und eine Neuberechnung der Bußgelder zu fordern. Diese zusätzliche Komplexität kann auch die Bereitschaft von Gerichten erhöhen, Unternehmen aus anderen Gründen freizusprechen, sofern es (wie in der Praxis sehr häufig) auch andere Aspekte gibt, unter denen verhängte Bußgelder angreifbar sind.
5. Fazit und Ausblick – auch auf Bußgelder nach dem EU AI Act
Die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-383/23 stellt einen bedeutenden Schritt in der Auslegung der DSGVO dar. Sie eröffnet Unternehmen neue Möglichkeiten zur Verteidigung in Bußgeldverfahren. Es bleibt abzuwarten, wie die Datenschutzbehörden und Gerichte in der EU auf diese Entscheidung reagieren werden. Unternehmen sollten die Gelegenheit nutzen, ihre Verteidigungsstrategien entsprechend anzupassen und die EuGH-Entscheidung als Grundlage für eine differenzierte und faire Bußgeldbemessung zu nutzen. Die EuGH-Entscheidung bietet eine neue Perspektive auf die Bußgeldbemessung nach der DSGVO und fordert eine Abkehr von pauschalen Berechnungsmodellen hin zu einer individuellen Bewertung der Umstände. Dies könnte langfristig vielleicht zu einer gerechteren und ausgewogeneren Durchsetzung der Datenschutzvorschriften führen.
Die Entscheidung ist übrigens auch für Geldbußen nach anderen EU Digitalrechtsakten bedeutsam. Denn deren Sanktionssysteme sind dem der DSGVO grundsätzlich nachgebildet. Allerdings gibt es auch einen wesentlichen Unterschied. So enthält etwa der EU AI Act auf Deutsch die KI-Verordnung kein Äquivalent zu Erwägungsgrund 150 DSGVO. Und der EuGH begründet seine Analogie zum Kartellrecht vor allem mit dem dort vorgesehenen Verweis auf Art. 101 und 102 AEUV. Ein solcher Verweis fehlt in anderen EU Digitalrechtsakten wie etwa dem AI Act oder dem Digital Markets Act (DMA) vollständig. Daher lässt sich eine solche Analogie bei diesen Rechtsakten auch nicht auf deren Erwägungsgründe stützen. Allerdings ist bei dem derzeitigen verbraucherfreundlichen Kurs des EuGH auch nicht gesetzt, dass er der Versuchung widerstehen wird, ein ähnliches Ergebnis mit Erwägungen zu Wirksamkeit und Abschreckung zu begründen.